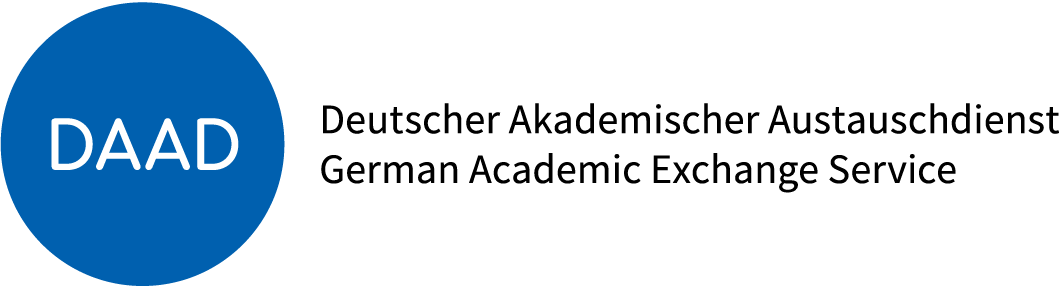Dr. Iuditha Balint
Dortmund, Deutschland
Neuere deutsche Literaturwissenschaft (Fachgebiet) - Neuere dt. Literaturwissenschaft (Lehrgebiet)
Kontaktinformationen:
Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt, Grubenweg 5, 44388 Dortmund
Forschungsgebiete
Besondere Forschungsgebiete
- Gegenwartsliteratur (mit Fokus auf 1990 ff.)
- Literarische Ökonomik
- Literatur der Arbeitswelt
- Begriffsgeschichte und historische Semantik
- Gattungstheorie und Gattungsgeschichte (Drama, Novelle)
- Erzähltheorie (Figur, Ereignishaftigkeit, Fokalisierung)
- #Metapherntheorie
Monographien Iuditha Balint: Erzählte Entgrenzungen. Narrationen von Arbeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Paderborn: Fink 2017.
Aufsätze und Beiträge
- Von der Fürsprache zur shared authority. Dinçer Güçyeters "Unser Deutschlandmärchen" (2022) als (post-)migrantisches Chorwerk. In: Zeitschrift für Germanistik 34, 2024, S. 147-165
- Balint, Iuditha / Lampart, Fabian / Humbert, Anna-Marie / Moser, Natalie / Navratil, Michael: Daniel Kehlmann und die Gegenwartsliteratur. Dialogische Poetik, Werkpolitik und Populäres Schreiben. In: Lampart, Fabian / Navratil, Michael / Balint, Iuditha / Moser, Natalie / Humbert, Anna-Marie (Hrsg.): Daniel Kehlmann und die Gegenwartsliteratur. Dialogische Poetik, Werkpolitik und populäres Schreiben. Berlin;Boston 2020 (= Gegenwartsliteratur : Autoren und Debatten), S. 1-10
- Ingeniöses Brüten. Denk- und Schreibpraxen und ihre Historizität bei Ernst Osterkamp und Manfred Pfister. In: Opus und labor. Arbeit in autobiographischen und biographischen Erzählungen. Hrsg. von Iuditha Balint, Katharina Lammers, Kerstin Wilhelms und Thomas Wortmann. Essen: Klartext 2018, S. 305–318.
- Lesenserinnerungen. Von unbedarften, kritischen und unkritischen Lektüren. Erscheint in: Literarische Werdegänge. Lesebiographien von Nachwuchswissenschaftler_innen. Hrsg. von Kathrin Heintz und Walter Kühn, unter Mitarbeit von Laura Dexheimer. Marburg: Büchner 2018. S. 40–57.
- Balint, Iuditha / Parr, Rolf: Von "factory workern" und Sucharbeitern. Zwei Ansätze zur Untersuchung von Arbeit als diskursivem und semantischem Phänomen. In: Weimarer Beiträge 2018, S. 244-257
- »Paradigmenwechsel«? Alte und neue Ökonomie in Christoph Peters’ Erzählung Heinrich Grewents Arbeit und Liebe. Erscheint in: Schlusspunkt. Poetiken des Endes. Hrsg. von Markus Engelns, Kai Löser und Immanuel Nover. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017. S. 83–102.
- Die Frage literarhistorischer Genrezuordnungen. Erika Runges Bottroper Protokolle (1968) und Kathrin Rögglas wir schlafen nicht (2004). In: Kathrin Röggla. Hrsg. von Iuditha Balint, Tanja Nusser und Rolf Parr. München: edition text + kritik 2017. S. 15–32.
- Dreifach subjektiviert. Dimensionen entgrenzter Arbeit in literarischen und wissenschaftlichen Texten. In: Wirtschaft erzählen. Narrative Formatierungen von Ökonomie. Hrsg. von Irmtraud Behr, Anja Kern, Albrecht Plewnia und Jürgen Ritte. Tübingen: Narr 2017. S. 135–150.
- Bedeutungsoffen. Semantiken von Arbeit vor und in der Goethezeit. In: Goethe und die Arbeit. Hrsg. von Miriam Albracht, Iuditha Balint und Frank Weiher. Paderborn: Fink 2017. S. 9–18.
- Diskurs, Erzählung, Drama. Zur Darstellung der Finanzkrise in Jonas Lüschers Novelle "Frühling der Barbaren". In: Peter-Weiss-Jahrbuch für Literatur, Kunst und Politik im 20. und 21. Jahrhundert 2015, S. 147-168
- Ökonomie und die Suche nach dem guten Leben. Ewald Palmetshofers 'faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete'. In: Andreas Englhart, Artur Pełka (Hrsg.): Junge Stücke. Theatertexte junger Autorinnen und Autoren im Gegenwartstheater. Bielefeld: transcript 2014. S. 211-222.